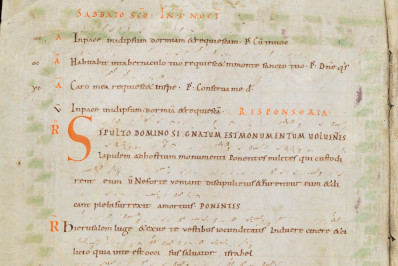Vom römischen (und monastischen) Offizium zur heutigen Liturgia Horarum[1]
„Mangels anderer liturgischer Quellen für diesen Tag kommt dem Stundengebet am Karsamstag eine besondere Bedeutung zu, wenn man den Charakter dieses Tages genauer bestimmen will.“[2] Dem ist insofern beizupflichten, als liturgisches Feiern ein primärer locus theologicus ist;[3] und doch verschafft erst das Fehlen „anderer Quellen“ der Stundenliturgie entsprechende Aufmerksamkeit. Die allgemeine Wahrnehmung dieser Gottesdienstform seitens der meisten Gläubigen und im kirchlichen Leben vieler Gemeinden ist leider wenig anders.[4] „Zur Tagzeitenliturgie an den drei Tagen vor Ostern“ weiterlesen