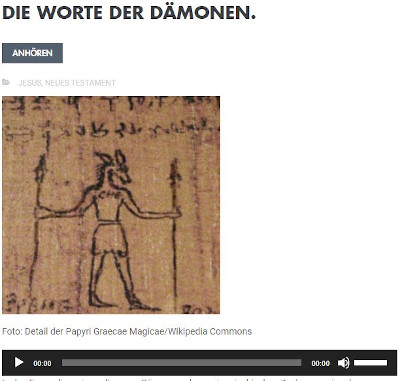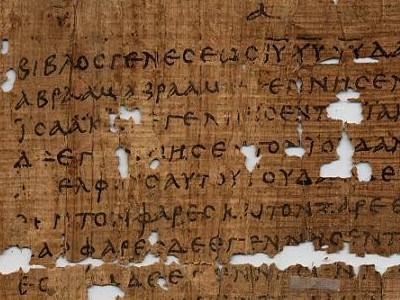Was für eine Szene![1] Das Fest, dem in der katholischen Leseordnung dieser eindrucksvolle Text zugeordnet ist, hatte seit seiner Entstehung im 4. Jahrhundert in Ost und West variierende Namen und Inhalte: aus dem ursprünglichen Marientod – ihrer Entschlafung und Versetzung aus dem Grab in den Himmel – wurde ihr aktiver Hinübergang, volkstümlich Mariä Himmelfahrt. 1950 als Dogma verkündet, feiert die katholische Kirche am 15. August nun korrekt formuliert die passive leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel.
Die Worte der Dämonen
Eine „Achtung Bibel!“ -Sendung von Stefanie Jeller am 19. Jänner 2022, radio klassik Stephansdom.
In den Evangelien wimmelt es von Dämonen, ebenso in griechischen Zauberpapyri und in der ägyptischen apokalyptischen Literatur. Der Bibel-Experte Oliver Achilles, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Theologischen Kursen, hat die Texte verglichen und verblüffende Ähnlichkeiten entdeckt. So werden die Worte der schreienden Dämonen im Markusevangelium im Vergleich mit den magischen Papyri aus Ägypten ein Stück weit verständlicher. – Ein Ausflug in die Welt der Dämonenaustreibungen und Gegenbeschwörungen.
Hier die Sendung zum Nachhören: https://radioklassik.at/die-worte-der-daemonen/
Gottes Namen in den Handschriften der Bibel
Angefangen mit den Büchern des Alten Testamentes wurden die Texte der Bibel gut zweitausend Jahre lang von Schreibern kopiert und so von Generation zu Generation weitergeben. Unsere heutige Art, das Wort Gottes in gedruckter oder elektronischer Form zu lesen, ist in der Geschichte der Bibel eine späte Entwicklung. Wie die Schreiber der Antike ihre Texte geschrieben haben, ist allerdings nicht nur eine technische, sondern auch eine theologische Frage, da ihre Frömmigkeit sich aus der Art herauslesen lässt, wie sie ihrer Aufgabe nachgekommen sind.
Auf dem Weg des Verstehens nach Emmaus
Lukas erzählt im letzten Kapitel seines Evangeliums von zwei Anhängern Jesu (von denen er nur einen namentlich nennt), die auf dem Weg nach Emmaus waren. Auf diesem Weg sprachen sie über die tragischen und beunruhigenden Ereignisse in Jerusalem im Zusammenhang mit der brutalen Hinrichtung des Menschen, auf den sie so große Hoffnungen gesetzt hatten. Auf die Rückfrage eines dazu gekommenen Fremden beschreiben sie ihn als Propheten, von dem sie die Erlösung Israels erhofften. „Auf dem Weg des Verstehens nach Emmaus“ weiterlesen
Menschenrechte im Deuternomium (Dtn) – ein Überblick
Von Mag. Dr. Dr. Oskar Dangl (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems)
„Menschenrechte im Deuternomium (Dtn) – ein Überblick“ weiterlesen
Judentumsvergessenheit bei Papst Franziskus? Evangelii Gaudium und anderen Dokumenten auf der Spur
Beitrag von Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonach / Universität Innsbruck
Würden die Artikel 247 bis 249 von Evangelii Gaudium isoliert stehen, so könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass Papst Franziskus jegliche christliche Judentumsvergessenheit komplett überwunden und ad acta gelegt habe. Er anerkennt das nachbiblische Judentum als notwendiges Korrektiv zu manchen christlichen Entwicklungen, er sieht es als Selbstverständlichkeit, dass christliche Theologie nicht losgelöst von jüdischer Theologie betrieben werden kann, und er ist von zwei gleichberechtigten Heilswegen überzeugt. Damit bringt er die katholisch-jüdische Verhältnisbestimmung um einen Quantensprung weiter. Die besagten Artikel finden sich nun aber im Kontext eines Dokuments, das von tiefem missionarischem Eifer und dem erklärten Ziel einer Neuevangelisierung der ganzen Welt geprägt und so auch vom Geist des universalen Heilsanspruchs Christi (und auch der Kirche) durchweht ist. Das Judentum wird davon zwar irgendwie ausgenommen, wie das aber letztlich im Detail unter einen Hut gebracht werden kann, lässt der Papst offen. Dennoch öffnet er zweifelsfrei eine Tür für weitergehende theologische Interaktionen der Kirche bzw. des Christentums mit dem Judentum. Dass auch in seinem engeren Umfeld nicht alle bereit sind diese Tür zu durchschreiten, ist offenkundig. Bleibt nur zu hoffen, dass Franziskus sich in dieser Frage nicht beirren lässt und dass jene, die seinen Weg mitzutragen bereit sind, ihm auch entsprechend den Rücken stärken. „Judentumsvergessenheit bei Papst Franziskus? Evangelii Gaudium und anderen Dokumenten auf der Spur“ weiterlesen
Glaubensbekenntnis in der Bibel
Die Hebräische Bibel kennt mehrere Verben mit der Bedeutung „bekennen“. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in einer Form stehen, die man als „kausativ“ (=verursachend) bezeichnet. So hat das Verb „schreiben“ in seiner kausativen Form die Bedeutung von „diktieren“ – also jemanden zum Schreiben veranlassen. Das bedeutet: Ein Bekenntnis wird in der hebräischen Bibel immer durch jemanden verursacht. Niemand kann von sich aus bekennen. Derjenige, der dieses Bekenntnis auslöst, ist der biblische Gott. Ihm wird eine Eigenschaft zugeschrieben, die man auf Deutsch als „Zuverlässigkeit“ oder „Treue“ übersetzen kann. Die Treue des HERRN, die Israel erfahren hat und erfährt, ist Ursache des Bekenntnisses zu seinem Gott. „Glaubensbekenntnis in der Bibel“ weiterlesen
Wo ist das Reich Gottes?
Im Lukas-Evangelium – und nur dort – bekommt Jesus einmal die Frage gestellt, wann denn das Reich Gottes komme? Seine Antwort ist merkwürdig: »Das Königtum Gottes kommt nicht in beobachtbarer Erscheinung. Auch wird man nicht sagen: Da – hier ist es! Oder – dort ist es! Das Königtum Gottes ist entos hymon. (Lk 17,20-21; Ü. nach Fridolin Stier). „Wo ist das Reich Gottes?“ weiterlesen
Sprechende Namen in der Bibel
Wenn bei Johann Nestroy ein Kaffeesieder Gschloder heißt, dann hat dieser sprechende Namen eine konkrete Bedeutung. Wer das Wort nicht kennt, wird allerdings eine Erklärung brauchen, um diesen Namen zu verstehen. Ähnlich verhältlich es sich mit den sprechenden Namen der Bibel, die in dem kleinen Büchlein Rut gehäuft auftreten. „Sprechende Namen in der Bibel“ weiterlesen
Wer sein Kind liebt, der schlägt es?
Zu den verrufenen Versen aus dem AT gehört der aus Spr 13,24: Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn, wer ihn liebt, nimmt ihn früh in Zucht. In dieser Form muss man den Eindruck gewinnen, dass hier die Prügelstrafe für Kinder gefordert wird. „Wer sein Kind liebt, der schlägt es?“ weiterlesen